Vielfalt bei der jüdischen Woche
Rückblick auf die zahlreichen Veranstaltungen, die einen erfreulichen Zuspruch erlebten
ROTHENBURG – Mit dem Film „Die Wohnung“ ging am Mittwoch, 23. Oktober, im Kino-Forum Rothenburg die dritte Rothenburger Woche jüdischer Kultur zu Ende. Das Programm war in diesem Jahr besonders dicht gestrickt mit acht Veranstaltungen in neun Tagen.
Umso erfreuter zeigten sich die Veranstalter Dr. Oliver Gußmann (für das Evangelische Bildungswerk) und Kulturwissenschaftlerin Annika Keller, darüber, dass insgesamt mehr als 300 Besucher das breit gefächerte Veranstaltungsangebot wahrnehmen. „Uns ist es in den letzten Jahren gelungen, ein kleines Stammpublikum zu gewinnen“, erklärt Dr. Gußmann. Zugleich schaffe die Themenvielfalt der Veranstaltungen interessante Zugänge für neues Publikum.
Den Auftakt machten die jüdischen Kulturvermittlerinnen Dr. Esther Graf und Manja Altenburg aus Heidelberg, die lebensnah in Gebräuche des Judentums einführten und dabei viele Fragen aus dem Publikum beantworteten. Einen Beitrag zum interreligiösen Dialog lieferte Prof. Dr. Martin Stöhr mit seinem Vortrag über „Luthers Sündenfall“, der sich mit dem Antisemitismus des großen Reformators auseinandersetzte und dabei auch einen Blick über die Grenzen hinweg auf andere Reformatoren warf. So war beispielsweise Calvin den Juden gegenüber offener eingestellt als Luther, der noch 1543, kurz vor seinem Tod, in einer Schmähschrift verlangte, „dass man ihren Rabbinern verbiete, zu unterrichten“. Eine Lesung mit Diskussion zu den Hintergründen des Nahostkonflikts leistete den Brückenschlag zur aktuellen politischen Situation in Israel und bereicherte die Kulturwoche um eine neue Facette (Der Fränkische Anzeiger berichtete).
Die Themenvielfalt der Woche wird jedoch vor allem auch durch die Beteiligung anderer etablierter Kulturveranstalter und Kulturschaffender gewährleistet: So lud die Stadtbücherei zusammen mit der Volkshochschule Rothenburg zu einem unterhaltsamen Abend mit dem Rezitator Gerhard Berghofer und den Satiren Ephraim Kishons ein und Kirchenmusikdirektor Ulrich Knörr steuerte eine wahre Rarität bei: Er spielte auf der Rieger-Orgel ein Konzert mit synagogaler Orgelmusik in der St. Jakobskirche.
Orgelmusik in der Synagoge war in jüdischen Gemeinden sehr umstritten, trotzdem gab es sie ab 1810 in liberalen Gemeinden. Die Werke der dabei führenden Komponisten Louis Lewandowski, Moritz Deutsch und Josef Löw sind stilistisch anderen Kompositionen der Romantik sehr nah. Die als „typisch jüdische Musik“ in den Köpfen gespeicherten Klezmer-Klänge spielen in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle. Zwischen den einzelne Stücken las Dr. Oliver Gußmann Texte wie das Kaddisch und ein jüdisches Nachtgebet, aber auch eine zeitgenössische Beschreibung der Synagoge von Rothenburg. In ihr gab es keine Orgel: Die kleine Rothenburger Gemeinde war eher orthodox ausgerichtet.
Einen Höhepunkt der ersten Rothenburger Woche jüdischer Kultur rief der Film „Überleben im Versteck“ der Dokumentarfilmgruppe Rothenburg unter der Leitung von Thilo Pohle ins Gedächtnis. 2011 hatte eine Gruppe Schüler aller weiterführenden Rothenburger Schulen innerhalb von einer Woche ein Erzähltheaterstück einstudiert, das sich mit den Schicksalen jüdischer Kinder auseinandersetzte, die den Holocaust im Versteck, getrennt von ihren Eltern, überlebten. Der Film zeigt eine der Aufführungen in voller Länge und ergänzt sie mit Interviews, welche die Dokumentarfilmer mit den beteiligten Schülern führte. Bei der Filmvorführung im hiesigen Kino waren sechs Schüler anwesend und berichteten sehr anschaulich und berührend von ihren Eindrücken.
Dem Gedenken an die Opfer des Holocausts war auch die Stadtführung am 22. Oktober gewidmet. Genau 75 Jahre zuvor waren an diesem Tag die letzten Juden aus Rothenburg verjagt worden. Seit April diesen Jahres erinnern Stolpersteine in der Altstadt an diese Menschen, von denen in vielen Fällen nicht viel mehr als Namen und Geburtsdaten bekannt sind. Die Teilnehmer an der Führung besuchten einige der Stolpersteine, die im abendlichen Dunkel mit warm scheinendem Kerzenlicht beleuchtet waren.
Annika Keller und Dr. Oliver Gußmann gelang es, mit einer Mischung aus Lebensgeschichten, Zeitzeugenberichten und literarischen Texten die Personen und ihre Schicksale für einen Moment greifbarer zu machen. Die Bedrückung unter den Teilnehmenden war spürbar, doch gelang es, den Blick am Ende nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auf eine Zukunft zu richten, in der Derartiges nicht mehr geschehen soll. Ganz im Sinne des Mottos der Woche: Le’Chaijm. Auf das Leben! ler




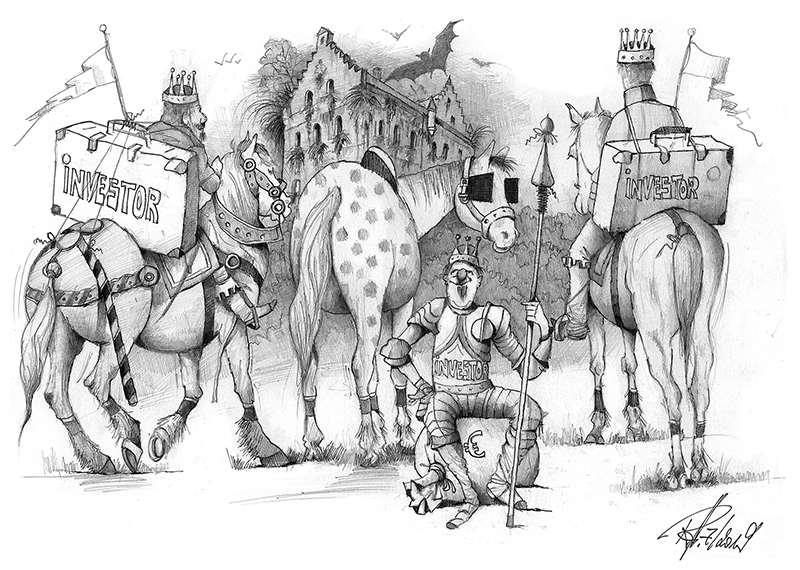
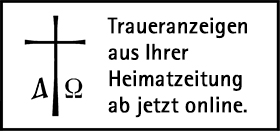

Schreibe einen Kommentar