Pubertär oder depressiv?
Kinder- und Jugendpsychologin sensibilisierte Eltern und Lehrer für Tabuthema
ROTHENBURG – Welche Eltern von Teenagern kennen das nicht? Früher oder später kommt der Punkt, an dem der Nachwuchs sich zurückzieht, alles irgendwie doof findet, grundsätzlich auf Konfrontation zu den Eltern geht und bislang heißgeliebte Freizeitbeschäftigungen auf Eis legt. Doch wo hört „normales“ pubertäres Verhalten auf und wo beginnt eine Depression? Kinder- und Jugendpsychologin Caroline Kettner sensibilisierte Eltern und Lehrer bei ihrem Vortrag in der Aula des Reichsstadt-Gymnasiums für Faktoren, Symptome und Therapiemöglichkeiten bei einer Depression im Kindes- und Jugendalter.

Die acht Schauspieler/innen, die vier Tage das innovative Theaterstück einstudiert und danach vorgestellt haben. Fotos: Scheuenstuhl
Weltweit sind zirka 322 Millionen Menschen von Depressionen betroffen, das entspricht mehr als 4,4 Prozent der Weltbevölkerung. In Deutschland leiden 5,3 Millionen Erwachsene (8,2 Prozent) darunter. Bei Kindern im Vorschulalter sind es ein Prozent und im Grundschulalter zirka zwei Prozent. Bei Jugendlichen steigen die Fallzahlen dann an. So leiden etwa drei bis zehn Prozent der 12- bis 17-Jährigen an einer Depression. Mädchen sind dabei doppelt so häufig davon betroffen wie Jungen, auch später im Erwachsenenalter.
Aufgrund dieser Zahlen spricht die Stiftung Deutsche Depressionshilfe von einer Volkskrankheit. Dabei gehören Depressionen zu den am meisten unterschätzten Erkrankungen bezüglich der Lebensbeeinträchtigung. Sie haben auf sämtliche Bereiche, also Familie, soziale Kontakte, Schule und Beruf, negative Auswirkungen. Zudem erhöhen sie das Suizidrisiko. So ist Selbstmord im Jugendalter die zweithäufigste Todesursache nach dem Verkehrsunfall.
„Grundsätzlich ist jede Depression individuell in ihrem Erscheinungsbild“, erklärt die Kinder- und Jugendpsychologin Caroline Kettner. Der Übergang von einem normalen pubertären Entwicklungsverlauf mit all seinen neuen und für Eltern he- rausfordernden Begleit-erscheinungen hin zu einem depressiven Zustand sind fließend. Zumal kurzzeitige depressive Verstimmungen an sich schon Teil der Pubertät sind. Für psychologische Laien, namentlich Eltern und Lehrer, ist es deshalb oft sehr schwer, eine Depression zu erkennen.

Caroline Kettner
Emotionale Bandbreite
Symptome, die einer Pubertät zu eigen sind, werden erst dann zu einer depressiven Störung, wenn mehrere davon gleichzeitig vorliegen, diese eine bestimmte Intensität erreichen, über eine gewisse Zeit andauern und im Leben der Betroffenen zu Beeinträchtigungen oder Leiden führen. Die Bandbreite an Emotionen reicht dabei – je nach Alter – vom energiegeladenen, lauten und unzufriedenen Jugendlichen über den verzweifelten, häufig weinenden Teen-ager bis hin zu jenen, die anfällig für einen erhöhten Drogen- und Alkoholkonsum werden, weil dadurch depressive Antriebslosigkeit und Müdigkeit zumindest für kurze Zeit ins Gegenteil verkehrt werden.
Darüber hinaus gebe es eine Gruppe, die häufig übersehen werde, so die Expertin, nämlich diejenigen Jugendlichen, die versuchen, weiterhin gut zu funktionieren und perfekt zu sein, in der Hoffnung, dass sich dadurch ihre Gemütsverfassung wieder verbessere. Die drei Hauptsymptome einer Depression bei Jugendlichen sind dieselben wie bei Erwachsenen: emotionale Niedergeschlagenheit, Freud- und Interessenlosigkeit und verminderter Antrieb und schnellere Ermüdung.
Hinzu kommen noch eine ganze Reihe alterstypische Symptome, die nicht alle erfüllt sein müssen, damit man von einer Depression sprechen kann. Neben psychosomatischen Störungen, die sich durchaus auch in Form von Asthma oder Neurodermi-tis äußern können, sind hier beispielsweise auch ein vermindertes Selbstvertrauen, Apathie, Probleme in der Entscheidungsfähigkeit, Appetitverlust- oder Anstieg sowie ein erhöhtes Suizidrisiko zu nennen.
Probleme mit der Konzentration
Laut einer Studie leiden 90 Prozent aller an einer Depression erkrankten 14-Jährigen unter Konzentrationsproblemen. 70 Prozent haben Einschlafschwierigkeiten und 52 Prozent kommen aus dem Morgentief nicht mehr heraus. Depressive Störungen lassen sich durch das Zusammenwirken von biologischen (wie etwa die hormonelle Veränderung in der Pubertät), psychologischen (beispielsweise ein verzerrtes, negatives Bild von sich, anderen und der Zukunft) und sozialen Einflüssen (unter anderem eine geringe Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind) erklären. Sie seien häufig „komorbid“, also treten in der Folge einer anderen Störung wie ADHS, Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens oder Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dyskalkulie) auf.
Hilfe sollte man sich, laut der Expertin, dann holen, wenn die Symptome schon länger bestehen und immer intensiver werden, eine deutliche Lebensbeeinträchtigung bei dem Betroffenen und der Familie festzustellen ist und man keinen eigenen Weg mehr hinaus findet. Doch das ist leichter gesagt als getan. Da es viel zu wenige niedergelassene Therapeuten gibt, ist eine Wartezeit von eineinhalb bis zwei Jahren keine Seltenheit. Zumindest bei einer akuten Selbstmordgefährdung ist Hilfe ga-rantiert. Denn in so einem Fall muss das Bezirkskrankenhaus Ansbach den Betroffenen aufnehmen.
Therapiemöglichkeiten bei einer Depression umfassen Psychotherapie sowie in untergeordneter Rolle auch die medikamentöse Einstellung, aber auch eine stationäre Behandlung und Jugendhilfemaßnahmen können nötig sein. Um bei der Behandlung „einen Fuß in die Tür zu bekommen“, wie es die Psychologin nennt, setzt man bei der Kognitiven Verhaltenstherapie bei den Gedanken und dem Verhalten des Betroffenen an.
Verständnis entwickeln
Ihrer Erfahrung nach können Eltern ebenfalls positven Einfluss auf ihr betroffenes Kind haben. So sei es wichtig, Verständnis zu entwickeln, sich in das Kind hineinzuversetzen, sich Zeit nehmen, Zuneigung und Interesse zeigen sowie Talente zu fördern und zu viel Stress und Belastungen reduzieren. Caroline Kettner empfiehlt außerdem, immer wieder das Gespräch ohne Vorwürfe und Zwang anzubieten sowie zu Unternehmungen und kleinen Aktivitäten zu ermutigen. Auch das Einbinden in familiäre Tätigkeiten wie Essen oder Einkaufen könne bei einer Depression helfen.
Aber auch Lehrer sind nicht vollkommen hilflos angesichts eines depressiven Schülers in ihrer Klasse. Bei Auffälligkeiten oder Veränderungen können sie das Gespräch mit dem jeweiligen Schüler und/oder den Eltern suchen – zeitnah und mehrfach, aber ohne Abwertung und Bloßstellung. Möglich ist auch, sich schulische Entlastungen zu überlegen, den Schulpsychologen einzubeziehen sowie auf externe Hilfen zu verweisen.
Auf Initiative der schuleigenen „StiL-Gruppe“ („Stark ins Leben“) wurde endlich einmal Licht auf das Tabuthema „Depression“ geworfen. Und die gut besuchte Aula bei dem Vortrag zeigte, dass bei Eltern und Lehrern ein sehr großes Interesse daran besteht, mehr darüber zu erfahren. Ergänzt wurde diese, wenn man so möchte, Themenwoche durch die Ausstellung „LebensBilderReise“ des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege.
Auch wenn die Ausstellung durch Inhalt, Optik und den Einsatz von Medien besticht, so richtig zu fassen bekommt man Kinder und Jugendliche vor allem, wenn man sie direkt einbezieht. Und deshalb holte man sich das Theaterprojekt „Ice Breaker“, unterstützt von der AOK Bayern, an die Schule. Bei psychischen Erkrankungen erfolgt das Erkennen und Eingreifen oft zu spät. Aber gerade bei Jugendlichen lasse sich mit Prävention „viel abfangen“, erklärt Horst Leitner, AOK-Regionalleiter.
Und so verbrachten insgesamt acht Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe die erste Woche nach den Weih-nachtsferien damit, das innovative und interaktive Theaterstück einzu-üben. Unter der Leitung von Theaterpädagoge Jean-François Drozak machten sie sich daran, nicht nur den Text auswendig zu lernen, sondern die Gefühle und Verhaltensweise der Protagonisten zu reflektieren. Das Stück wurde einmal für die Eltern und andere Interessierte und zweimal für die Schüler aufgeführt. Das schulische Publikum durfte sich dabei nicht nur einfach von dem Schauspiel berieseln lassen, sondern war zum Mitdenken aufgefordert. Anhand einer Check-Liste sollte jeder für sich ermitteln, ob Robert oder Anna – so die Namen der beiden Hauptfiguren – einfach nur regulär pubertär verstimmt oder an einer Depression erkrankt sind.
Die Zuschauer wurden aber nicht nur für die Symptome und das typische Verhalten bei einer Depression sensibilisiert. Das Stück sollte auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Geschwister von erkrankten Jugendlichen ebenfalls Begleitung und Unterstützung brauchen. mes




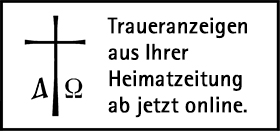

Schreibe einen Kommentar