Mit den Nonnen lernen
Zwei Cousinen blicken auf ihre Zeit an der Mädchenrealschule zurück
SCHILLINGSFÜRST – Sie hatte ob ihrer schulischen und werteorientierten Erziehung einen sehr guten Ruf weit über die Grenzen des Landkreises hinaus: Die Mädchenrealschule Schillingsfürst wurde 1873 als Institut der Armen Schulschwestern gegründet. Mittlerweile steht sie auch Jungen offen. Gabi Kuch und Monika Klenk, zwei Cousinen aus Gailnau, waren Mitte der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre Schülerinnen am „Institut“. Sie erlebten noch die Zeiten, in der das pädagogische Personal fast ausschließlich aus Nonnen bestand und die Schule für einige Mädchen durch das Internat zu einem zweiten Zuhause wurde.

Monika Klenk blättert in Erinnerungen aus ihrer Internatszeit.
„Geschadet hat’s nicht“, sagt Monika Klenk über ihre Zeit an der Mädchenrealschule Schillingsfürst. Und auch ihre Cousine findet, „lernen musste man sowieso überall“. Ein Abschluss vom „Institut“ war bei damaligen Arbeitgebern aber besonders gern gesehen. Gabi Kuch besuchte nach der Volksschule in Gailnau von 1968 bis 1972 die Mädchenrealschule Schillingsfürst. Zu ihrer Zeit wurden die Schülerinnen noch bis auf wenige Ausnahmen von Schulschwestern unterrichtet. Die heute 60-Jährige kann sich noch gut an die dortigen Bedingungen und auch so manche Eigentümlichkeit erinnern. „Die Schwestern waren sehr dahinter, dass wir in den Pausen Bewegung bekommen“, erzählt sie. Sich für einen Plausch auf Treppen oder Mäuerchen zu setzen kam überhaupt nicht in Frage. Die Schülerinnen mussten stattdessen – unter der Aufsicht einer Nonne – ständig „im Kreis laufen“. Auch legte man zu jener Zeit ganz andere Maßstäbe an das Erscheinungsbild der Schülerinnen. „Geschminkt hat man sich damals sowiso noch nicht für die Schule“, erinnert sich Gabi Kuch, die während ihrer Schulzeit eine textile Umbruchphase miterlebte: Den Schülerinnen, die nicht das Internat besuchten, war es mittlerweile erlaubt im Winter mit Hosen zur Schule zu kommen. Davor mussten sie sich für den Unterricht zuerst im Keller umziehen. Gabi Kuch verbrachte als externe Schülerin nur die Vormittage im „Ins-titut“. Ab und an übernachtete sie aber auch dort wenn beispielsweise Exerzitien auf dem Unterrichtsplan standen. „Die externen Schülerinnen waren meist evangelisch, die anderen überwiegend katholisch“, erinnert sie sich. Eine dieser Internatsschülerinnen war in den Jahren ‘64 bis ‘67 ihre Cousine Monika Klenk.

Gabi Kuchs Abschlussfoto ‘72: Schülerinnen durften neuerdings auch Hosen tragen. Fotos: privat/Scheuenstuhl
„Ich hatte wahnsinniges Heimweh“, berichtet diese. Denn wie die anderen Internatsschülerinnen durfte auch sie nur alle acht Wochen nach Hause fahren – obwohl ihr Zuhause im wenige Kilometer entfernten Gailnau stand. Die Tochter eines Schreinermeisters litt an einem Defekt an der Wirbelsäule. Das „Institut“ war die geeignete Schule, um danach einen Beruf zu erlernen, bei dem sie keine körperlich schweren Arbeiten verrichten musste. Aus diesem Grund bekam sie die Schulgebühren von 130 Mark pro Monat bezahlt. Gerade unter den Internatsschülerinnen gab es viele Mädchen, etwa aus Ansbach, Herrieden oder Erlangen, deren Eltern betucht waren. Monika Klenk habe sich deshalb „teilweise deplatziert“ gefühlt. Im Allgemeinen sei aber der „Zusammenhalt schon groß“ gewesen. Monika Klenk war in einem der letzten Jahrgänge, die noch in den großen Schlafsälen mit bis zu 20 Betten untergebracht waren. Spanische Wände hinter denen die Waschschüsseln standen, gaukelten Privatssphäre nur vor. Durch den Umbau bekamen die Mädchen dann schließlich Zweibett-Zimmer. Das Kruzifix, sakrale Wandbilder und ein Weihwasserkessel gehörten dabei zur Grundausstattung. Jede Nacht machten die Schwestern ihre Runde, damit Ruhe in die Zimmer einkehrte. „Wir haben aber trotzdem immer noch geratscht“, schmunzelt Monika Klenk. Und für eine Prüfung hat man auch schon mal unter der Decke mit einer Taschenlampe gelernt. Die Nonnen konnten einfach nicht immer und überall ein Auge auf ihre Mädchen haben. Wenn die Schillingsfürster Jungs mal unter den Fenstern der Schülerinnen gepfiffen haben, haben die Mädchen auch heruntergeschaut.

Gabi Kuch bereut ihre Zeit am „Institut“ nicht.
„Wir waren halt zwischen 12 und 16 Jahre alt und mitten in der Pubertät, da hat man sich schon für Jungs interessiert“, gibt Gabi Kuch zu. „Wir haben sie aber im Unterricht nicht vermisst, vielleicht waren wir dadurch sogar etwas disziplinierter.“ Man schmuggelte auch mal den einen oder anderen Zettel an einen potenziellen Verehrer nach draußen. Aber getürmt sei keine der Schülerinnen, versichert ihre Cousine. Die Nonnen nahmen ihre Aufsichtspflicht für die Mädchen äußerst ernst. So mussten sich die Schülerinnen beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes bei der Pförtnerin melden. Spaziergänge allein oder in der Gruppe durch Schillingsfürst am Wochenende waren ohne die Begleitung einer Nonne nicht erlaubt. An eine einzige Ausnahme von dieser Regel kann sich Monika Klenk erinnern: Wenn die Mädchen für die Kochstunde Fleisch bei der Metzgerei im Ort holen sollten. Aber auch Besucher konnten sich nicht frei im Schulhaus bewegen. Man führte sie in ein Besucherzimmer und die jeweilige Schülerin wurde dann dorthin gebracht. Selbst die private Korrespondenz mit Freunden und Familie wurde von den Schwestern gelesen. Monika Klenk hat sogar noch einen Brief von sich an ihre Großeltern, dem eine Nonne einen persönlichen Gruß hinzugefügt hatte. Mit derselben Sorgfalt, mit der man auf das Betragen der Mädchen achtete, wurde ihnen auch der Lehrstoff vermittelt. „Die Schwestern haben sich um jede Einzelne bemüht“, findet Gabi Kuch. Und Monika Klenk ergänzt: „Dadurch konnten auch Mädchen gefördert werden, die es vielleicht auf einer staatlichen Schule schwer gehabt hätten.“ Die Nonnen gaben Nachhilfe und betreuten ebenso die externen Schülerinnen bei den Hausaufgaben. Es sei deshalb auch nur sehr selten vorgekommen, dass eine Schülerin eine Klasse wiederholen musste. Obwohl sich die Schule in kirchlicher Trägerschaft befand (und noch immer befindet), legte man dort dieselben Prüfungen ab, wie an staatlichen Schulen. Das Ziel der Ausbildung war nicht in erster Linie aus den Mädchen lediglich die perfekte Hausfrau zu machen. Auch wenn Handarbeit und Kochen zum Pflichtprogramm gehörte. Es wurde trotz unterschiedlicher elektrischer Küchengeräte großen Wert darauf gelegt, so kochen zu lernen, als ob es diese Helferlein nicht gebe.

Grabmal für die „Armen Schulschwestern“ in Schillingsfürst.
Was damals laut Monika Klenk allerdings fehlte: „Man hatte vor dem Abschluss keinerlei Kontakt mit der richtigen Arbeitswelt, dagegen ist es heute möglich mal zu schnuppern, welcher Beruf einem gefallen könnte.“ Am meisten profitierten die Schülerinnen von den Werten, die im „Institut“ vermittelt wurden. „Es ging einem in Fleisch und Blut über alles ganz korrekt zu machen und ehrlich zu sein“, erklärt Monika Klenk. Den Schwestern und vor allem den Leiterinnen wurde größter Respekt entgegengebracht. Wenn die Direktorin das Klassenzimmer betrat, hieß es Stillstehen und keinen Mucks machen. Die Oberin wurde mit „ehrwürdige Mutter“ angesprochen. Die Schwestern waren Respektspersonen, auch wenn die Schülerinnen sie ab und an unter sich als „Pinguine“ bezeichneten. Sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht, was die Nonnen wohl zum Schlafen anziehen und wie ihre Haare unter den Hauben aussehen. Wie in jeder Schule so gab es auch am „Institut“ Lehrer, mit denen man gut auskam und solche, mit denen es etwas schwieriger war. Bei den beiden Cousinen und vielen ihrer Mitschülerinnen war Schwester Gerlanda die beliebteste Nonne. „Sie war jung und offen und hat zu den Schülerinnen gehalten, ihr konnte man sich anvertrauen“, sagt Monika Klenk begeistert. Ihre Cousine hat Schwester Gerlanda als äußerst eifrig und tatkräftig in Erinnerung: In den Wochen vor der Abschlussprüfung in Stenograph kam sie jeden Tag fünf Minuten vor acht Uhr ins Klassenzimmer und las einen Text vor, den die Schülerinnen als Übung stenographieren mussten.
Viel Gutes hat Monika Klenk aus ihrer Zeit in Schillingsfürst mitgenommen. Es gibt aber eine Sache, mit dem sie zumindest kurz nach dem Abschluss „erstmal nichts zu tun“ haben wollte. Man wurde damals „total vollgebombt mit Religion“, empfand sie. Gerade bei den katholischen Internatsschülerinnen war das mehrmalige Beten an der Tagesordnung. Bereits vor der Schule, teilweise um sechs Uhr, fand eine Frühmesse statt. Und am Sonntag war der Gottesdienstbesuch in der Institutskirche natürlich Pflicht. Noch heute treffen Monika Klenk und Gabi Kuch regelmäßig ehemalige Mitschülerinnen. Einige wohnen in der Umgebung, mit anderen kommen sie zumindest bei den alle fünf Jahre stattfindenen Klassentreffen zusammen, um über ihre gemeinsame Zeit an der Schule zu sprechen. Bei ihrem letzten Klassentreffen bekamen sie die Gelegenheit von Schulleiterin Barbara Hofmann durch die Räumlichkeiten geführt zu werden. „Die Fußböden im Physiksaal sind immer noch dieselben“, entdeckte Monika Klenk. Die meisten ehemaligen Schülerinnen sind sich einig, dass die Öffnung der Mädchenschule für Jungen eine sinnvolle Entscheidung war, um diese traditionelle Bildungseinrichtung zu erhalten. mes
In einem folgenden Artikel erzählen ehemalige Schülerinnen, zwei Schwestern, von ihrer Schulzeit am „Institut“ in den 80er und 90er Jahren. Eine ihrer Töchter besucht momentan die Edith-Stein-Realschule und hat deren Öffnung zur Schule für Mädchen und Jungen miterlebt.




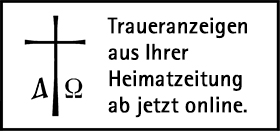

Schreibe einen Kommentar